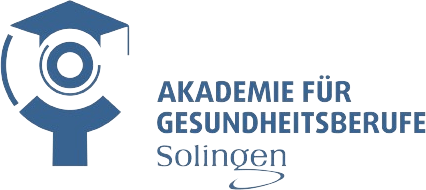Ursachen und Risikofaktoren
Die häufigsten Ursachen für eine Fraktur sind:
- Stürze (z. B. bei älteren Menschen mit Osteoporose)
- Verkehrs- oder Sportunfälle
- Direkte Gewalteinwirkung, etwa durch Schlag oder Stoß
- Pathologische Veränderungen wie Tumore oder Osteoporose
Vor allem bei älteren Menschen stellt die verminderte Knochendichte einen bedeutenden Risikofaktor dar. Auch Stoffwechselerkrankungen oder eine langfristige Kortisontherapie können das Frakturrisiko erhöhen.
Formen und Klassifikation
Frakturen werden unter anderem nach dem Verlauf der Bruchlinie, dem Zustand der Haut und der Anzahl der Knochenfragmente klassifiziert. Einige Beispiele sind:
- geschlossene Fraktur: Haut bleibt intakt
- offene Fraktur: Knochen durchdringt die Haut
- Trümmerfraktur: Knochen zerfällt in mehrere Fragmente
- Spiral-, Quer- oder Schrägfraktur: je nach Bruchverlauf
Eine besondere Gruppe stellen pathologische Frakturen dar. Sie entstehen durch Knochen, die bereits durch Vorerkrankungen geschwächt sind, und nicht zwangsläufig durch große äußere Einwirkungen.

Symptome
Als Frakturzeichen bezeichnet man die klinischen Symptome, die auf eine Fraktur hindeuten. Diese werden in sichere und unsichere Anzeichen unterteilt.
Sichere Frakturzeichen
- Tastbare Stufenbildung
- Pathologische Beweglichkeit
- Krepitation (hör-/fühlbares „Reiben“)
- Achsenabweichung des betroffenen Knochens
- Sichtbare Knochenfragmente bei offener Fraktur
Unsichere Frakturanzeichen
- Hämatome
- Schmerzen
- Schwellungen (z.B. Ödem)
- Bewegungseinschränkung
Diagnostik und Therapie
Zur Diagnostik einer Fraktur werden in der Regel Röntgenaufnahmen angefertigt. Bei komplexeren Brüchen oder Gelenkbeteiligung kommen auch CT oder MRT zum Einsatz.
Die Therapie richtet sich nach Art und Schwere der Fraktur. Es gibt konservative Maßnahmen wie Ruhigstellung mittels Schiene oder Gips, sowie operative Verfahren wie die Osteosynthese. Dabei werden Knochenfragmente mithilfe von Schrauben, Platten oder Marknägeln wieder stabilisiert.
Heilungsprozess und Nachsorge
Die Heilung erfolgt in mehreren Phasen, beginnend mit der Entzündungsreaktion, gefolgt von der Kallusbildung und anschließender Knochenumbauphase. Der gesamte Prozess kann, abhängig von Patientenzustand und Frakturart, mehrere Wochen bis Monate dauern.
Zur Nachsorge gehören regelmäßige Verlaufskontrollen sowie die frühzeitige Mobilisation, um Komplikationen wie Thrombosen oder Muskelabbau zu vermeiden. Physiotherapeutische Maßnahmen fördern die Beweglichkeit und Stabilität des betroffenen Bereichs.